„Entweder du hasst es oder du liebst es. Du wirst es wissen, wenn du Great Barrier das erste Mal siehst“, haben sie gesagt. An diesem schwülen Freitagnachmittag im September hab ich mich verliebt.
Schwül und regnerisch war es, als ich am 5. September in Tryphena von der Fähre gekrochen bin. Die Überfahrt von Auckland, 90 Seemeilen weiter südlich, wie eine Schotterpiste aus Wasser und Wellen. Kotzübel war mir.
„Entweder du hasst oder du liebst es. Du wirst es wissen, wenn du Great Barrier das erste Mal siehst“, haben sie gesagt. An diesem Freitagmittag im September hab ich mich verliebt.
Ich bin nicht auf einer Insel gestrandet, ich bin eingetaucht in ein soziales Experiment, so echt und so unwirklich, meine persönliche Trueman-Show.
800 Menschen leben auf Great Barrier Island, auf einer Fläche nur unmerklich größer als die von Frankfurt am Main. Die meisten wohnen im Süden der Insel, in Tryphena, Medlands, Kaitoke und Claris. Einige leben im Norden rund um Port Fitzroy, so einsam, dass manche Häuser in einsamen Buchten nur per Boot zu erreichen sind. Und die Menschen dort sehen sich alle verdächtig ähnlich. „Imbread-County“ nennen es die Städter aus Tryphena.
Es gibt drei Grundschulen auf Great Barrier, sind die Kinder alt genug, verlassen Sie die Insel und verbringen ihre Teenager-Jahre in Internaten rund um Auckland.
Einmal die Woche bringt die Fähre Vorrat für die Tante-Emma-Läden, in den größeren Orten. Dringendes fliegt das Lufttaxi ein. Und wenn es tagelang stürmt, kommt eben kein Nachschub. Die Regale werden leerer, Gemüse ist als erstes weg und die Menschen leben von Konserven, denen die salzige Meerluft Rost aufpinselt.
Eine Infrastruktur für Strom und fließend Wasser gibt es nicht. Jedes Haus hat einen eigenen Diesel-Generator, Solar-Panels auf dem Dach und mindestens zwei Wassertanks, denn die Sommer sind lang und trocken.
Wer nach Barrier kommt, um hier zu leben, entscheidet sich gegen Luxus, gegen Bequemlichkeit, gegen Anonymität. Der entscheidet sich für die Einfachheit, die Herausforderung, für eine Gemeinschaft, in der keiner allein gelassen wird. Niemals, nirgendwo. Es ist manchmal eine Qual.
An der Oberfläche scheint es, als ob auf der Insel nicht viel passiert – alles ruhig im dichten Busch mitten im Ozean. Taucht man ein die Gemeinschaft, spürt man da Wuseln.
Klar es gibt die, die den lieben langen Tag nicht mehr tun als zu trinken und sich das Maul über die kleinen Insel-Nichtigkeiten zerreißen, sich im Pub zu betrinken und dann im Aschenbecher einzuschlafen. Und es gibt die, die den Motor am Laufen halten – im wahrsten Sinne.
Einer von ihnen ist Blacky*. Blacky managt die Radiostation Aotea FM, ein gemeinnütziges Projekt, moderiert von freiwilligen DJs, Profit gleich null. 13,5 Stunden jeden Tag ist Aotea FM auf Sendung, eben solange die Sonne scheint, denn auch die Station speist sich ausschließlich aus der Energie, die die Solar-Panels liefern. Stürmt es tagelang, muss jemand eben anders für Saft sorgen.
Und dieser jemand ist Blacky. Bei Sturm und Regen kraxelt er jeden Morgen, jeden Mittag und jeden Abend die 300 Meter hinauf und gießt Diesel in den Generator, damit Great Barrier seine Tunes hören kann. Aotea FM ist sein Herzensprojekt – das, was seine Insel zusammenhält.
Sein Tiraden-artiger Wetterbericht ist berüchtigt. Drei Mal die Woche, eine sehr lange halbe Stunde lang, alle Infos zu Wind und Wellen für Fischer, Surfer und den Rest, der irgendwie auf der Insel zu tun hat.
Blacky weiß, von was er spricht. Er ist selbst Fischer und ein echter Surferboy, nur ein wenig in die Jahre gekommen. Dass er mal Preise für seine Künste als Wellenreiter gewonnen hat, sieht man dem drahtigen, wettergegerbten Kerl an.
Vor 35 Jahren hat er sein Haus an Medlands-Beach gebaut: ein Kasten aus Holz, vier Wänden, ein Dach. Reicht. Durch die Ritzen pfeift der Wind, Regen tropft durch das Dach. Im Sommer wird es unerträglich heiß.
Dort lebt er mit seinem 12-jährigen Sohn, einem hyperaktiven Autisten mit der Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfischs. Die Mutter ist kurz nach dessen Geburt gestorben.
Blacky hätte allen Grund, depressiv zu sein. Das war er auch, in Auckland, bevor er seinen Sohn nach Barrier gebracht hat. Es war ein Versuch; er nennt es Kur. Kein halbes Jahr hat es gedauert und es ging beiden besser. Great Barrier heilt.
„Von außen sieht es vielleicht so aus, als ob wir ein Haufen Loser sind, die es woanders nicht geschafft haben“, sagt Blacky. „Doch die meisten von uns haben sich bewusst dazu entschieden hier zu leben.“
Blacky kam mit 20 das erste Mal nach Barrier. Schon damals wusste er, dass er hier hängen bleibt. Er hat sich verliebt und musste wiederkommen.
Vier Monaten war ich auf Great Barrier Island, vier Monate in diesem Insel-Dorf, vier Monate mit Menschen und ihren Geschichten, vier Monate mit mir selbst. Ich habe mich verliebt und ich werde wiederkommen.
* Name geändert

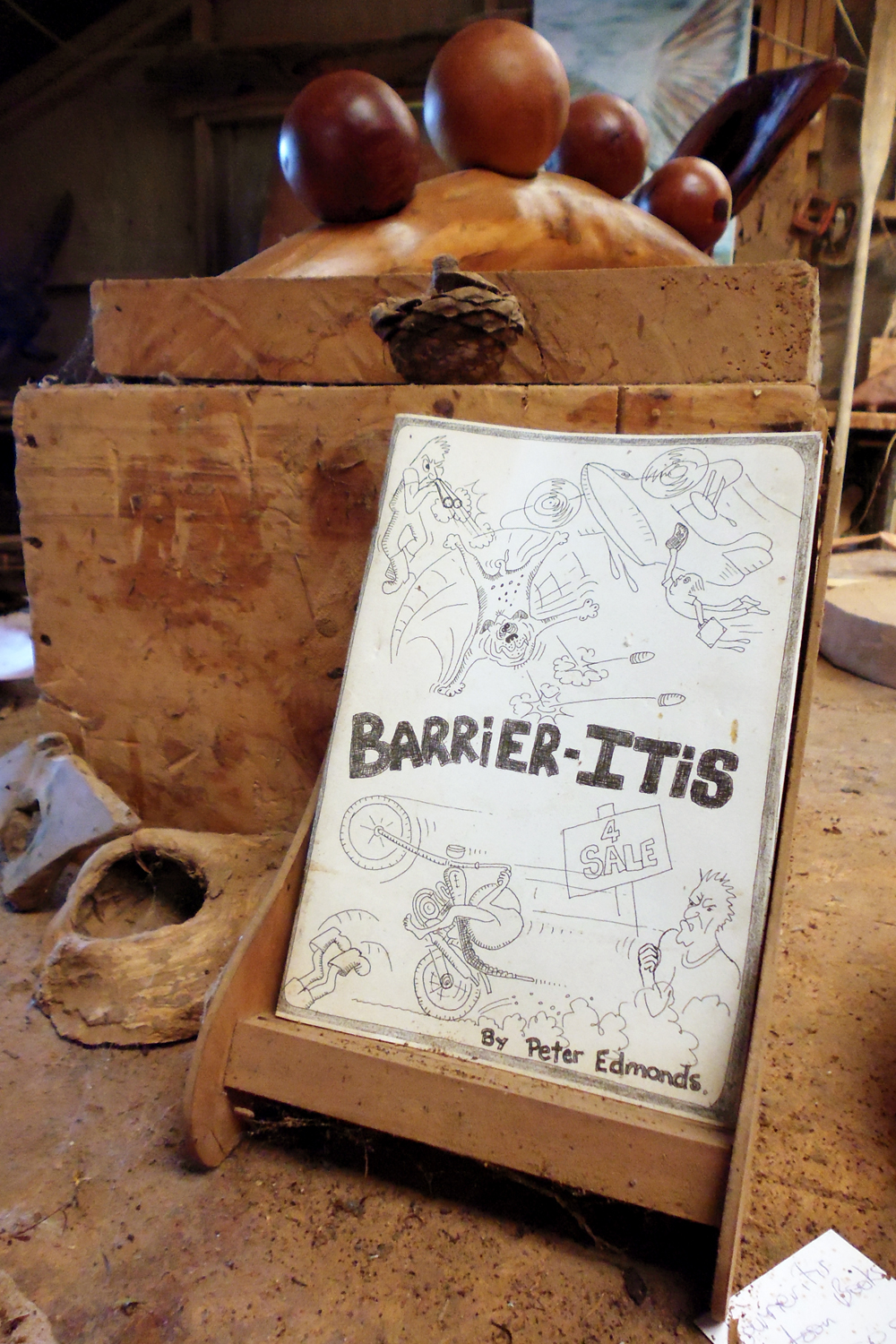



















2 comments
Hi Pia, schoene Bilder und dazu ein ruehrender und fuer den Barrier zeitloser Text. Schade, dass wir uns erst in den letzten Tagen deines Aotea-auftenthaltes getroffen haben.
Brownie, wie so einige hier, leben eher luxurioes und haben relativ gesehen priviligierte Jobs. Gesellschaftlich ist Neuseeland, Motu Aotea ist da nicht anders, ein Land der Superlative, der Uebertreibungen und der Schwaetzer.
Ich bin, nach wie vor, und durch persoenliche Erfahrung, begeistert von den Menschen (hier), die tatsaechlich hart arbeiten muessen und koennen. Tag ein, Tag aus malochen sie, leben in sehr bescheidenen Verhaeltnissen, diese haben sie mit ihren eigenen Haenden und nicht durch Beauftragung anderer aufgebaut. Deren Durchhaltevermoegen, Selbstlosigkeit und praktisches Sachwissen ist lobenswert.
Die ‚Backbones‘ der Insel sind diese Frauen und Maenner, und mir tut es im Herzen weh zu sehen wie den Stimmen dieser Personen, wie anscheinend in sogenannten modernen Gesellschaften ueblich, nur wenig Gewicht zugetragen wird. Es wird ihnen zugehoert, aber gemacht wird was gut auf Papier gut aussieh. Passion scheint wichtiger zu sein als Kompetenz.
Die Politik auf Aotea ist vernebelt mit Visionen und wie eine Zwiebel. Je mehr man reinschaut, desto mehr stinkts.
Schoene Grues/e aus den Tryphena Heights, Ben
Jap, du lebst ja schone ganze Weile dort und hast tiefere Einblicke. Während meines kurzen Gastspiels auf Barrier hab ich nur an der Oberfläche gekratzt. „Passion wichtiger als Kompetenz“ und „Durchhaltevermögen, Selbstlosigkeit und praktisches Sachwissen“ beschreibt’s recht gut. Tolle Menschen. Und ja schade, dass wir uns so spät dort kennengelernt haben. Aber Leben ist lang und man trifft sich immer zwei Mal 🙂